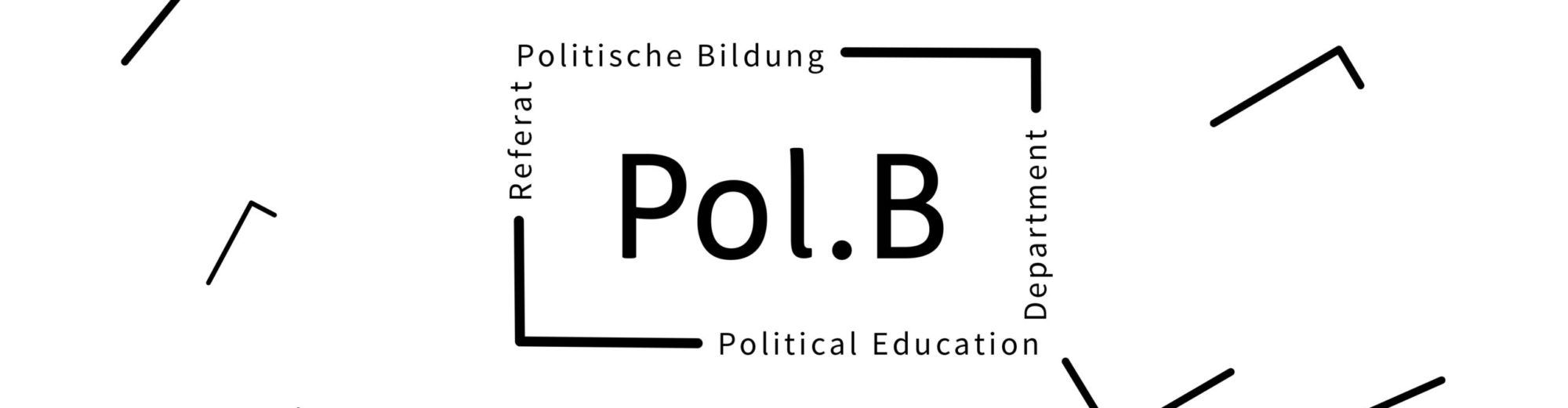{:de}Im Frühjahr schrieben wir nach der präsidialen Ausrufung des „Jetzt erst Recht!“-Semesters einen offenen Brief an das Präsidium. In diesem wollten wir der Universitätsleitung zum einen Facetten der Lebensrealitäten von Studierenden während der ersten Einschränkungen durch die Pandemie vermitteln.
Außerdem sprachen wir uns, so wie Studierendenorganisationen in ganz Deutschland, für eine solidarische Herangehensweise an die Krise aus. Wir forderten vom Präsidium, sich in den entsprechenden hochschulpolitischen Instanzen in Thüringen und ggf. bundesweit für die am stärksten von der Situation betroffenen Studierenden einzusetzen. Zuallererst für schnelle Hilfe und Unterstützung für sozial und ökonomisch schwächere Studierende, um finanzielle Not zu lindern — mit besonderer Rücksicht auf internationale Studierende und ihre spezielle rechtliche Situation als Nicht-Staatsbürger*innen. Weiterhin plädierten wir mit Studierenden deutschlandweit für eine Aussetzung der Regelhaftigkeit des Studiums angesichts der Ausnahmesituation. Also eine Aussetzung der Zählung des Sommersemesters als Fachsemester mit den festgelegten Studiensemesterzahlen und den damit verbunden Konsequenzen wie Verlust von Bafög-Förderung und Langzeitstudiengebühren.
Um diese Anliegen in ihrer Dringlichkeit zu unterstreichen und Studierende in diese sie betreffenden hochschulpolitische Prozesse einzubinden, luden wir sie dazu ein, den Brief mit zu unterzeichnen.
200 Studierende schlossen sich den Forderungen an. Wir blieben weiter im Gespräch mit der Studierendenvertretung StuKo und dem Präsidium.
Im öffentlichen Diskurs meldeten sich Lehrende, Studierende und Gewerkschaften aller Bundesländer zu Wort. Auch dem großen Druck auf lokaler Ebene und in sozialen Netzwerken ist es wohl zu verdanken, dass das Bundesministerium schließlich doch noch ein finanzielles Notpaket für Studierende in prekärer finanzieller Situation startete. An der Bauhaus-Uni wurde auch ein Fonds von Seiten des Freundeskreises eingerichtet. Für beide Fonds mussten Studierende allerdings genaue Nachweise über ihre finanzielle Bedürftigkeit erbringen — eine große Hürde für Menschen, die in diesen Monaten existenzielle Sorgen hatten. Zumindest gab es an unserer Universität besondere Hilfsangebote für Internationals — wir hatten auch auf die spezielle Situation jener Studierenden aufmerksam gemacht, die in dieser globalen Krise nicht in ihre Herkunftsländer zurückkehren konnten, und deren finanzielle und rechtliche Situation besonders unsicher war.
Die Corona-Krise hat globale und soziale Ungleichheiten schmerzlich offengelegt. Auch wurde offensichtlich, wie konstruiert und menschengemacht, wie veränderbar und offen unsere sozialen Institutionen sind, und wie schnell das öffentliche Leben, Gesetze und Regelhaftigkeiten mit entsprechendem Willen umgestaltet werden können. Vor allem in der ersten Phase der Ungewissheit von März bis Mai 2020 zeigte sich auf unterschiedlichen Ebenen deutlich, nach welchen Interessen und Werten politische und öffentliche, private und wirtschaftliche Institutionen handelten. Vielen Menschen wurde auch bewusster, was sie sich von eben diesen Institutionen erwarten, und welche Verantwortung diese tragen.
Das von so vielen wie auch von uns geforderte “Solidarsemester” sollte an die Verantwortung einer Universitätslandschaft appellieren, die wir als öffentlich, der freien Lehre und Forschung in Einheit und der Kunstfreiheit verpflichtet, als offen zugänglichen und diskriminerungsfreien Ort verstehen wollen. Diese Idealform der Universitäten positioniert sich im Gegensatz zur “unternehmerischen” Universität, unabhängig von ökonomischen Interessen und arbeitsmarktbezogener Ausbildung einförmiger Absolvent*innen. Hochschulpolitik kann dabei auch von Studierendenvertreter*innen geprägt werden, beziehungsweise haben zuletzt die Bildungsstreiks 2009 angesichts der Einführung der Studiengebühren gezeigt, dass auch die Masse an Studierenden durchaus politische Kraft hat.
Der gesamte Forderungskatalog des “Solidarsemesters” hätte ein starkes hochschulpolitisches Bekenntnis zu einem Universitätsideal jenseits des “Unternehmerischen” erfordert.
“Solidarität” bedeutet eben nicht, sich nach den Bedürfnissen einer starken Mehrheit zu richten, und den Bedürfnissen einer schwachen Minderheit mit Wohltätigkeit zu begegnen. Solidarität bedeutet die Absicherung des Ganzen, den möglichen Ausgleich der Nachteile von Menschen zu suchen, die auf welche Weise auch immer nicht gleichgestellt sind. Solidarität sichert ein hürdenloses Anrecht auf Unterstützung, ohne Menschen die in Not sind, zu entblößen. Solidarität bedeutet dabei auch manchmal, auf eigene Privilegien zu verzichten, um anderen Menschen gleiche Teilhabe zu ermöglichen [1]. Wären die Forderungen des “Solidarsemesters” umgesetzt worden, hätte allerdings kein*e einzige*r Studierende*r daraus einen Nachteil gezogen oder Privilegien eingebußt. Hätte eine breite Masse der Studierenden im Frühjahr 2020 Solidarität mit den weniger privilegierten Studierenden gezeigt, wären die Forderungen womöglich auch umgesetzt worden. Und nicht zuletzt, wären Solidarität, Gerechtigkeit und Gleichstellung im Zugang zu Bildung Interessen der Hochschulen und ihrer Präsidien, wären die Forderungen vor den Länderministerien und im Bund lauter zu hören gewesen.
“Solidarität für eine offene Gesellschaft” [2] an der Bauhaus-Universität wäre dann nicht nur ein Lippenbekenntnis. Wie zum Beispiel der Leiter der Hilfsorganisation medico Thomas Gebauer sagt, “Solidarität verlangt nach gesellschaftlichen Institutionen, die für Ausgleich und Teilhabe und damit für ein würdevolles menschliches Zusammenleben sorgen.[…] Solidarität ist weit mehr als das Gefühl innerer Verbundenheit. Solidarität steht für die Verpflichtung aller, für das Ganze einzustehen.”[3]
In anderen Bundesländern und an anderen Universitäten wurden Forderungen des Solidarsemesters, zum Beispiel nach der Nicht-Zählung als Fachsemester, umgesetzt, während in Weimar das “Jetzt-Erst-Recht”-Semester startete.
Erst jetzt schaffen wir es auch, gewissermaßen einen Zwischenstrich zu ziehen. Erst in einigen Jahren werden wir alle die langfristigen Auswirkungen der im Frühjahr 2020 getroffenen Entscheidungen einordnen können.
Wer und wie viele haben die Universitäten verlassen müssen? Wer und wie viele nehmen in der jetzigen Situation erst gar kein Studium auf, wenn sie es nur mit prekären und unsicheren Arbeitsverhältnissen und ohne soziale Absicherung aufnehmen können? Wer und wie viele werden in Zukunft durch die krisenbedingt privat, auf Banken oder vom Staat aufgenommenen Studienkredite in finanzielle Notlagen geraten?
Wie viel wird Bildung und Forschung der Politik in den nächsten Jahren wert sein? Wie viele Studiengänge und Stellen werden gestrichen, wie viele Labore geschlossen, wie viele Standorte gefährdet? Welchen Wert werden Kunst und Kultur haben? Wie stark werden sich die Universitäten als “unternehmerisch” positionieren?
Wie wollen wir studieren und lehren, wie wollen wir als Gesellschaft zusammenleben? Wie begegnen wir diesen offenen Wunden der Ungleichheit, die wir aufgrund der Corona-Pandemie kaum noch ignorieren können?
Die bundesweite “Solidarsemester”-Initiative hat diesen Fragen eine Öffentllichkeit gegeben. Studierende wurden für Ungleichheiten untereinander und ökonomische und soziale Ungleichheiten sensibilisiert; und einige Studierende dahingehend, die Universität als einen öffentlichen, politischen Raum wahrzunehmen, in dem sie ihre Stimme erheben können.
Gleichzeitig hat die Situation offengelegt, dass das Verständnis solidarischer Konzepte an Universitäten langfristig gestärkt werden könnte, sowie die Studierenden ihrer politischen Macht besser Gewahr werden sollten.
Die Folgen des Frühjahrs 2020 und der darauf folgenden Monate werden sich erst in den nächsten Jahren zeigen. Es ist zu vermuten, dass die Ungleichheit die wir heute mehr denn je wahrnehmen, nicht durch Untätigkeit verschwinden wird. Solange sich alle Beteiligten im universitären System nicht als solidarische Einheit verstehen, die bereit ist, für offene, freie Wissenschaft, Kunst, Forschung und Lehre einzutreten, ist zu bezweifeln, dass diese Ideale aufrecht erhalten werden können. Solange die Universitäten in der Bildung ihrer Absolvent*innen nicht auch als Institution “Solidarität” als aktives Konzept vorleben und so vermitteln, ist außerdem zu bezweifeln, dass unsere und die folgenden Generationen resilient den auf uns zukommenden Wirtschafts‑, Finanz‑, Gesundheits- und Klimakrisen begegnen können.{:}{:en}In spring we wrote an open letter to the presidium after the presidential proclamation of the “now more than ever!” Semester. In this, we wanted to convey to the university management facets of the realities of life of students during the first restrictions caused by the pandemic.
In addition, like student organizations throughout Germany, we advocated for a solidary approach to the crisis. We asked the Presidium to stand up for the students most affected by the situation in the relevant university-politics bodies in Thuringia and possibly nationwide.
First and foremost, for quick help and support for socially and economically weaker students to alleviate financial hardship — with special consideration for international students and their special legal situation as non-citizens.
Furthermore, we advocated with students throughout Germany for a suspension of the regularity of studies in view of the exceptional situation. So a suspension of the counting of the summer semester as a normal semester with the specified number of study semesters and the associated consequences such as loss of student loans and long-term study fees.
In order to underline these concerns in their urgency and to involve students in these university-politics processes that affect them, we invited them to co-sign the letter. 200 students joined the demands.
We stayed in conversation with the student union StuKo and the presidium.
Lecturers, students and trade unions from all federal states spoke up in the public discourse. It is also thanks to the great pressure on the local level and in social networks that the Federal Ministry finally started a financial emergency package for students in a precarious financial situation.
At the Bauhaus University, a fund was also set up by the Freundeskreis. For both funds, however, students had to provide precise evidence of their financial need — a major hurdle for people who had existential worries during these months. At least there were special offers of help for internationals at our university — we had also drawn attention to the special situation of those students who were unable to return to their countries of origin in this global crisis and whose financial and legal situation was particularly uncertain.
The Corona crisis has painfully exposed global and social inequalities. It also became apparent how constructed and wo*man-made, how changeable and open our social institutions are, and how quickly public life, laws and regularities can be reshaped with the appropriate will. Especially in the first phase of uncertainty from March to May 2020, it became clear at different levels which interests and values political and public, private and economic institutions acted on. Many people also became more aware of what they expect from these institutions and what responsibility they bear.
The “solidarity semester” called for by so many and by us should appeal to the responsibility of a university landscape that we want to understand as a public place, committed to free teaching and research in unity and artistic freedom, as an openly accessible and non-discriminatory place.
This ideal form of the universities positions itself in contrast to the “entrepreneurial” university, independent of economic interests and job market-related training of uniform graduates. University policy can also be shaped by student representatives, or the educational strikes in 2009, given the introduction of tuition fees, showed that the majority of students also have political power.
The entire catalog of demands of the “solidarity semester” would have required a strong university policy commitment to a university ideal beyond the “entrepreneurial”.
“Solidarity” does not mean following the needs of a strong majority and meeting the needs of a weak minority with charity. Solidarity means securing the whole, trying to compensate for the disadvantages of people who are in whatever way not equal. Solidarity ensures a hurdle-free right to support without exposing people in need. Solidarity sometimes also means renouncing one’s own privileges in order to enable other people to participate equally.[1]
If the demands of the “solidarity semester” had been implemented, not a single student would have suffered a disadvantage or forfeited privileges. Had a broad mass of students shown solidarity with the less privileged students in spring 2020, the demands might have been implemented.
And last but not least, if solidarity, justice and equality in access to education were in the interests of the universities and their presidia, the demands would have been heard louder in front of the state ministries and in the federal government. “Solidarity for an open society” [2] at the Bauhaus University would then not be just lip service.
As, for example, the head of the aid organization medico Thomas Gebauer says “Solidarity demands social institutions that ensure balance and participation and thus a dignified human coexistence. […] Solidarity is much more than the feeling of inner connection. Solidarity stands for the obligation of everyone to stand up for the whole. ” [3]
In other federal states and at other universities, demands of the solidarity semester, for example not counting as a subject semester, have been implemented, while the “now more than ever” semester started in Weimar.
Only now do we manage to draw a line in between. Only in a few years will we all be able to classify the long-term effects of the decisions made in spring 2020.
Who and how many had to leave the universities? In the current situation, who and how many do not even start studying if they can only cope with precarious and insecure working conditions and without social security? Who and how many will find themselves in financial distress in the future due to student loans taken out privately, on banks or by the state as a result of the crisis?
How much will education and research be worth to politics in the next few years? How many courses and positions will be canceled, how many laboratories will be closed, how many locations will be endangered? What value will art and culture have? How strongly will the universities position themselves as “entrepreneurial”? How do we want to study and teach, how do we want to live together as a society? How do we deal with these open wounds of inequality, which we can hardly ignore due to the corona pandemic?
The nationwide “Solidarity Semester” initiative made these questions public. Students were made aware of inequalities among one another and economic and social inequalities; and some students to perceive the university as a public, political space in which to speak out. At the same time, the situation has revealed that the understanding of solidarity concepts at universities could be strengthened in the long term, and that students should become more aware of their political power.
The consequences of spring 2020 and the following months will only become apparent over the next few years. It can be assumed that the inequality we perceive today more than ever will not go away through inaction. As long as all those involved in the university system do not see themselves as a solidary unit that is ready to stand up for open, free science, art, research and teaching, it is doubtful that these ideals can be upheld.
As long as the universities do not exemplify “solidarity” as an active concept in the education of their graduates as an institution and convey it in this way, it is also doubtful that our and the following generations are resilient to the economic, financial, health and economic sectors be able to face climate crises.{:}